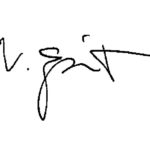Dieser Tage ertönen sie wieder, die Rufe nach Vater Staat. Das ist in der maritimen Wirtschaft genauso wie in anderen[ds_preview] Branchen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Es war eigentlich immer so, wenn dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen.
Nun ist die weltweite Schifffahrtsindustrie ein Stück weit selbst Schuld an ihrer Lage. Es gibt in fast allen Bereichen mehr Ladungsraumangebot als Nachfrage – obwohl der Welthandel trotz Rezessionsängsten noch immer auf hohem Niveau ist. Das ungezügelte Orderverhalten hat zu einer Überbauung geführt. Daher kam die zwischenzeitliche Wirtschaftserholung kaum in der Schifffahrt an.
Jetzt drohe »der Exitus eines ganzen Wirtschaftszweiges«, schrieben Ende Oktober niedersächsische Reeder an ihre Landesregierung. Sie befürchten, dass die »überwiegend deutschen Investoren, die mit ihrem Kapital erhebliche Sachwerte geschaffen haben, quasi ›über Nacht‹ ihr Geld zu Gunsten ausländischer ›Schnäppchenjäger‹ verlieren«. Als »konkrete Sofortmaßnahme« fordern sie von der Politik, dass sie sich bei den Banken für eine »weitere Verschiebung der Tilgungen sowie erforderlichenfalls die Zurverfügungstellung weiterer Überbrückungskredite« einsetzt.
Natürlich ist es aus Sicht jedes Unternehmers, dem das Wasser bis zum Hals steht, verständlich, nach Hilfe von oben zu rufen. Andererseits ist gerade die Schifffahrt mit der Tonnagesteuer und den – ab 2012 wieder in voller Höhe zur Verfügung stehenden – Lohnnebenkostenzuschüssen für deutsche Seeleute eine der am stärksten staatlich geförderten Branchen. Und wenn die hiesige maritime Wirtschaft vor 2008 ihren Teil zu den Überkapazitäten am Markt beigetragen hat – sei es durch zu optimistische Prognosen von Reedern, zu laxe Risikostrukturen der Banken bei der Kreditvergabe und »leichtes« Geld vom KG-Markt –, dann sind die unschönen Folgen eigentlich nicht Sache der Politik. Sollten amerikanische Private-Equity-Firmen oder an der New Yorker Börse notierte griechische Reeder jetzt »Marktopportunitäten« nutzen und günstig an Second-Hand-Schiffe kommen, greifen die Gesetze des Marktes, wozu auch – um noch einmal den Fachjargon zu bemühen – gut getimtes »Asset Play« gehört.
Situationen wie jetzt gab es in der Geschichte der Schifffahrt immer wieder. Vor genau 50 Jahren, im Dezember 1961, beschrieb der »Spiegel« unter dem Titel »Blaue Front«, wie die Reeder in Bonn um Staatshilfen bitten. Dabei ging es um Zinssubventionen und Abwrackprämien. Schuld an der Misere, urteilte der Autor, seien – »geblendet von den Erfolgen der Hochkonjunktur« – die »unökonomische Schiffbauwut«, der »Brauch, Kunden mit günstigen Krediten zu werben« und die Steuersparmodelle der Vermögenden. Die Folge: Die Frachtenhausse schlug in eine Baisse um, das Wort »Schiffsraummangel« blieb den Unternehmern »im Hals stecken«. Unermüdlich drückten sie nun die »SOS-Taste, um auch die Skeptiker zu überzeugen, dass die meisten Reeder nicht leben und nicht sterben können«.
Damals wie heute fragt man sich zweierlei: Wo ist all das Geld geblieben, das in guten Zeiten verdient wurde? Und soll der Staat marktwirtschaftliche Verwerfungen, so bitter sie für den einzelnen sein mögen, immer ausbügeln? Oder mit den Worten des damaligen Finanzministers Franz Etzel: »Sollen wir immer nur die Gewinne nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen bemessen und die Verluste sozialisieren?«