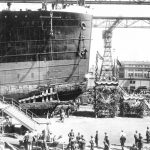Vor 175 Jahren wurde in Kiel der Grundstein für die spätere Großwerft HDW gesetzt. Jürgen Rohweder blickt zum Jubiläum auf die ereignisreiche Geschichte zwischen Schweffel & Howaldt und ThyssenKrupp Marine Systems zurück
Wer die unruhige Geschichte der Howaldtswerke – später nur noch kurz HDW genannt – verfolgt, wird feststellen, dass sich die Werft[ds_preview] ständig gewandelt hat. Denn anders würde es sie nicht mehr geben. Aber er wird auch feststellen, dass sich vieles wiederholt, und er wird eine Reihe von Déjà-vu-Erlebnissen haben.
In den 175 Jahren von Schweffel & Howaldt zu ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) war nur der Wandel eine Konstante. Ohne die Innovationskraft und die Flexibilität, sich auf neue Situationen einzustellen, hätte die Werft nicht überlebt. Wer die HDW als »Traditionswerft« bezeichnet, geht fehl. Denn das wäre das Beharren auf dem Althergebrachten. Und eben das hat HDW nie getan.
Schweffel trifft Howaldt
Zwischen der Ankündigung von Theaterstücken, Buchauktionen, Fahrgelegenheiten mit einer bequemen Kutsche nach Hamburg und amtlichen Bekanntmachungen findet sich im »Wochenblatt zum Besten der Armen in Kiel«, Nr. 36, vom 3. Oktober 1838 eine unscheinbare Anzeige: »Seit dem 1sten dieses Monats betreiben wir die auf der Rosenwiese befindliche Maschinenbauanstalt in Verbindung mit einer Eisengießerei unter der Firma von Schweffel & Howaldt für gemeinschaftliche Rechnung, welches wir hierdurch bekannt machen.«
Johann Schweffel und August Ferdinand Howaldt
Hier hatten sich zwei Männer gefunden, die sehr verschieden waren und sich doch prächtig ergänzten – der feingeistige und erfolgreiche Kaufmann Johann Schweffel (1796–1865) und der handfeste und tatenkräftige »Mechanikus« August Ferdinand Howaldt (1809–1883). Schweffel stammte aus einer der angesehenen Kieler Kaufmannsfamilien. Kerngeschäft der Schweffels war der Eisenhandel. Aber Schweffel besaß auch drei Schiffe, die Bark »Bürgermeister Jensen«, das zweitgrößte Schiff der Kieler Handelsflotte, die Brigg »Caroline« und den Raddampfer »Løven«. Dieses Schiff führte Schweffel und Howaldt zusammen. Und auf der »Løven« heuerte der »Mechanikus« Howaldt 1835 als Maschinist an. Howaldt stammte aus Braunschweig. Der Sohn eines Goldschmieds absolvierte in der Welfenstadt eine Lehre in praktischer Mechanik und arbeitete anschließend in Hamburg in einer mechanischen Werkstatt, die ihm die Stelle auf der »Løven« vermittelte. Die füllte er zur größten Zufriedenheit seines Chefs aus. Aus dem herzlichen Verhältnis zwischen dem Chef und seinem Angestellten wuchs die Partnerschaft zu »Schweffel & Howaldt«.
Die junge Firma bot eine breite Palette an Gerätschaften an, die von Dampfmaschinen, Dampfkesseln, Wasserleitungen, über Öfen und Herde bis hin zu Dezimalwaagen und Kochgeschirren reichte. Daneben machte sie sich einen guten Namen beim Bau von Kesselanlagen und Schiffsdampfmaschinen.
Mit Schweffel & Howaldt, die in den 1840er Jahren bis zu 180 Mitarbeiter beschäftigten, begann das Industriezeitalter in der Stadt an der Förde. Das Unternehmen war der bedeutendste Arbeitgeber der Stadt und expandierte weiter. 1853 errichtete es eine weitere Betriebsstätte am Kleinen Kiel. Der Betrieb am Hafen wurde die Maschinenfabrik und am Kleinen Kiel entstand eine neue Eisengießerei. Schiffbau war bei Schweffel & Howaldt eigentlich nicht vorgesehen. In der Zeit der schleswig-holsteinischen Erhebung baute das Unternehmen 1851 allerdings doch ein ungewöhnliches Schiff: den »Brandtaucher« nach den Plänen des bayerischen Unteroffiziers Wilhelm Bauer – ein U-Boot.
1879 schied die Familie Schweffel aus dem Unternehmen aus. Die drei Söhne Ferdinand August Howaldts führten die Firma ab 1880 unter dem Namen »Gebrüder Howaldt« fort und verlegten die Betriebsstätten von der Kieler Innenstadt an die Schwentine nach Kiel-Dietrichsdorf. Der Ort für die neue Fabrik war mit Bedacht gewählt. Denn »Gebrüder Howaldt« wurden direkte Nachbarn der Schiffswerft des ältesten Bruders, Georg Howaldt, der bereits 1865 eine erste Werft in Kiel-Ellerbek gegründet hatte und mit dem kleinen Dampfer »Vorwärts« den Howaldtschen Schiffbau begründete. Nach einem kurzen Intermezzo als Direktor der Norddeutschen Schiffbau Gesellschaft, aus der später die Germaniawerft wurde, gründete er 1876 wieder eine eigene Werft: »Georg Howaldt, Kieler Schiffswerft« in Kiel-Dietrichsdorf. Bereits im ersten Geschäftsjahr konnte er neun Schiffe abliefern und 1883 mit großem Pomp die Ablieferung des 100. Schiffes, der »Emma«, feiern.
Die Verbindung zwischen den beiden Howaldt-Unternehmen war immer eng gewesen – Maschinenfabrik und Werft profitierten erheblich voneinander. Und so war es ein logischer letzter Schritt, dass sich 1889 Maschinenfabrik und Werft ganz in einem gemeinsamen Unternehmen zusammenschlossen, das nun »Howaldtswerke« hieß und den Sprung vom mittelständischen Unternehmen zur Großwerft geschafft hatte.
Die ersten Jahre nach Gründung der Howaldtswerke waren eine Durstrecke, aber ab Mitte der 1890er Jahre zeichnen die Geschäftsberichte ein freundlicheres Bild. Allerdings verschlechterte sich die Ertragslage der Howaldtswerke bald wieder. Denn die Schifffahrt tauchte in das nächste Wellental der Konjunktur ab, und ein Großauftrag der russischen Marine geriet zum finanziellen Desaster, weil die Russen nicht zahlten. So gerieten die Howaldtswerke wie viele andere deutsche Werften in die Krise, die schließlich dazu führte, dass sich die Howaldts nach einem starken Partner umsahen und ihn 1909 in der Brown Boveri & Co AG in Mannheim und ihrer Tochtergesellschaft »Turbinia« fanden, die die Aktienmehrheit an den Howaldtswerken übernahmen und im Unternehmen nun den Ton angaben. Das führte letztlich 1910 zum Auszug der Familie Howaldt aus ihrer Werft.
Die Schiffe der Howaldts
Unter der Leitung der Familie Howaldt hatten Georg Howaldts Kieler Schiffswerft und die Howaldtswerke 536 Schiffe abgeliefert. Dem ersten Schiff »Vorwärts« folgte eine ganze Armada der unterschiedlichsten Schiffstypen, vorwiegend für zivile Auftraggeber, abgesehen von einigen Behördenschiffen. So entstanden auf den Hellingen von Georg Howaldt und den Howaldtswerken Frachter, Passagierschiffe, Fähren, Hafendampfer, Schlepper, Barkassen, Zollboote, Lotsenboote, unzählige Schuten, Prähme und Pontons, Schwimmdocks und Bagger. Ausnahmen blieben zwei Segelschiffe, das Polarforschungsschiff »Gauss«, einige Yach-
ten (darunter drei Dampfyachten mit dem Namen »Lensahn« für den Erbgroßherzog von Oldenburg), aber nur wenige Kriegsschiffe, wie 1904 der Kleine Kreuzer »Undine« und das U-Boot-Hebe- und Bergeschiff »Vulkan«, das 1908 abgeliefert wurde.
Brown Boveri: Dicke Pötte, Turbinen und Schwimmdocks
Der Turbinenhersteller Brown Boveri hatte ein starkes Interesse an der Kieler
Beteiligung, weil das Geschäft mit Schiffsturbinen, vor allem für die Kaiserliche Marine, für das Unternehmen außerordentlich wichtig war. Und so bedeutete die Beteiligung an den Howaldtswerken eine wesentliche Erweiterung ihres Geschäftes.
Begünstigt wurde das ehrgeizige Unterfangen dadurch, dass sich die Konjunktur für den Schiffbau 1910 langsam erholte und ab dem Folgejahr an Fahrt gewann. So entwickelte sich der Auftragsbestand der Werft dank steigender Frachtraten 1911 deutlich besser. Um diese Zeit beschäftigten die Howaldtswerke rund 3.500 Mitarbeiter, und sie waren die siebtgrößte Werft in Deutschland, also schon eine Großwerft.
Hohe Investitionen in den Ausbau der Werft geschahen nicht nur unter dem Gesichtspunkt, einen Schiffbauplatz anzulegen, auf dem die immer größer werdenden Dampfer gebaut werden konnten, sondern ebenso mit Blick auf den Marineschiffbau. Deshalb waren neue große Hellinge auch für den Bau großer Kreuzer und Linienschiffe geeignet, und mit Ausbruch des ersten Weltkrieges fand auf den Howaldtswerken praktisch nur noch Kriegsschiffbau statt. Auf der Werft arbeiteten zwischen 1914 und 1918 bis zu 4.700 Menschen. Doch mit dem Kriegsende brachen die Marineaufträge weg
Wenigstens lief das Reparaturgeschäft an – vor allem an ausländischen Schiffen, die »wertvolle Devisen« brachten. Weiter erschloss sich die Werft neue Geschäftsfelder: die Reparatur und Instandsetzung von Lokomotiven und Eisenbahnwaggons. Dann aber machten die galoppierende Inflation und danach die Umstellung auf die Rentenmark der Werft das Leben schwer. In dieser Situation verkaufte im Jahr 1924 Walter Boveri seine Aktienmehrheit an einen Konzern der Montanindustrie, die Rombacher Hüttenwerke in Koblenz.
Schiffbau in der Brown-Boveri-Ära
Mit dem Frachter »Monte Penedo« hatten die Howaldtswerke 1911 einen großen technischen Erfolg gefeiert. Er war das erste deutsche hochseegängige Dieselschiff und das zweite der Welt. Das Dieselzeitalter hatte begonnen. So schlug sich der Durst der Welt auf Erdöl auch in den Auftragsbüchern der Werft nieder: Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges lieferten die Howaldtswerke immerhin 16 Tanker ab.
Eine weitere Neuerung der Antriebstechnik: Schon vor dem Einstieg von Brown Boveri hatten die Howaldtswerke erste Versuche mit einem Turbinenschiff gemacht. Mit dem frühzeitigen Einstieg und die Diesel- und die Turbinentechnik marschierten die Howaldtswerke an der Spitze des Fortschritts.
Eine Spezialität der Howaldtswerke wurden ihre Docks. Georg Howaldt hatte sich schon in den 1870er Jahren mit der Technik von Schwimmdocks auseinandergesetzt. Bis Ende des Ersten Weltkrieges hatten die Howaldtswerke über 40 Docks aller Größen für das In- und Ausland gebaut.
Nach 1910 wurde die Kaiserliche Marine der wichtigste Kunde der Werft. Mit dem bereits erwähnten Kleinen Kreuzer »Undine« und dem U-Boot-Dock- und Bergeschiff »Vulkan« hatte sich die Werft bei der Marine Anerkennung erworben und sich damit das Eintrittsbillet für weitere Aufträge für mehrere Linien- und Schlachtschiffe verdient. Um das Kriegsende herum konnten die Howaldtswerke auch noch drei große Torpedoboote an die Kaiserliche Marine übergeben.
Erneut schwere Zeiten
Mit dem Konzern Rombach-Spaeter war nun ein Unternehmen der Montanindustrie neuer Eigentümer. Ein wesentlicher Grund für das Interesse an der Werft lag wohl auch darin, dass die Stahlindustrie nach Absatzmärkten suchte. Da kam ihr der Schiffbau gerade recht. Als Rombach-Spaeter die Howaldtswerke übernahm, befanden sich in keiner guten Lage. Hinzu kam, dass steigende Materialpreise und hohe Lohnkosten die Aufträge »außerordentlich verlustreich« gestalteten. Rombach-Spaeter hatte zwar die Werft anfänglich noch unterstützt, war dann aber selbst in die Krise geraten und somit keine Hilfe mehr. Auch alle Hoffnungen auf die öffentliche Hand waren vergebens. Es gab Anfang 1926 kaum eine Möglichkeit, die Liquidation des Unternehmens zu vermeiden.
Retter Heinrich Diederichsen
Am 15. September 1926 beschloss eine außerordentliche Generalversammlung die Liquidation der Werft. In dieser Situation nahte als »weißer Ritter« Heinrich Diederichsen. Der gebürtige Kieler mit einer Handelsfirma in Hamburg, ein Kaufmann mit weltweiten Verbindungen, nahm das Ruder in die Hand. Er bildete ein Konsortium, das die Werft als »Howaldtswerke AG« neu gründete.
Die Howaldtswerke expandierten: Im Januar 1929 übernahmen sie in Hamburg die marode »Schiffswerft & Maschinenfabrik (vormals Janssen & Schmilinsky)« und 1930 die ehemalige Vulcan-Werft in Hamburg und vereinigten die Neuerwerbungen unter dem Namen »Howaldtswerke Hamburg«. Die Howaldtswerke waren also auf dem besten Weg zur Gesundung, aber da schlug wie ein Blitz aus heiterem Himmel der »Schwarze Freitag« in die Weltwirtschaft ein. So sehr bei den Howaldtswerken 1929 die Zeichen auf Expansion und beginnenden Erträgen gestanden hatten, so sehr wurden auch sie von der Weltwirtschaftskrise getroffen. Immerhin konnten sich die Werften in Kiel und Hamburg mit Reparaturaufträgen einigermaßen über Wasser halten.
Howaldtswerke auf dem Weg in den Krieg
Nach 1934 begann sich das Geschäft langsam zu beleben. Der Aufschwung hielt an, denn die nationalsozialistische Wirtschafts- und Rüstungspolitik, die Deutschland zu einem neuen Angriffskrieg fähig machen sollte, sorgte zunehmend für Arbeit auf allen Standorten der Howaldtswerke. Schon 1937 herrschte Vollbeschäftigung. In diesem Jahr verkaufte Diedrichsen seine Anteile an der Werft, die er so lange über Wasser gehalten hatte, an die staatseigenen Deutschen Werke. Jetzt konnte sie alleine laufen.
Tatsächlich herrschte in Deutschland ein wahrer Schiffbauboom, und so konnten die Howaldtswerke 1938 in Kiel ihr 100. Jubiläum sehr zufrieden feiern. Doch mit der Kieler Freiheit war es bald vorbei. Denn das Werk Dietrichsdorf wurde aus den Howaldtswerken herausgelöst und mit dem Arsenal 1939 zur »Kriegsmarinewerft« zusammengelegt. Allein, die Zwangsehe mit dem Arsenal währte nicht lange. Nach nur dreieinhalb Jahren kauften die Howaldtswerke ihren Kieler Betrieb 1943 zurück.
Ab 1936 lieferten die Werften in Kiel und Hamburg an zivile Reedereien wie auch an die Kriegsmarine Frachter, Tanker, Fischdampfer, Schlepper, Hafendampfer und
U-Boot-Begleitschiffe ab. Für die Deutsche Lufthansa bauten die Kieler Howaldtswerke zwei völlig ungewöhnliche Schiffe: Die Katapultschiffe »Friesenland« und die größere »Ostmark« für den Überseedienst der Lufthansa. Renommierstück wurde der KdF-Passagierdampfer »Robert Ley«, das damals wohl größte diesel-elektrische Schiff der Welt.
Für die Kriegsmarine bauten die Howaldtswerke Trossschiffe und U-Boot-Begleitschiffe. Besondere Bedeutung erlangte im Krieg der Bau von U-Booten in Kiel und Hamburg. Von den insgesamt 116 Typ-VII-Booten, die zwischen 1941 und Kriegsende abgeliefert werden konnten, stammten 67 aus Kiel und 49 aus Hamburg. Am Bau der wegweisenden neuen U-BootTypen XXI und XXIII war Howaldt nicht beteiligt. Allerdings baute die Werft nach dem gleichen Grundprinzip im Sommer 1944 drei Prototypen des Kleinst-U-Boots vom Typ XXVII, den »Seehund«.
Doch was im Frieden mühsam aufgebaut worden war, fiel nur kurze Zeit darauf in Schutt und Asche. Kiel und Hamburg waren frühzeitig Ziel der alliierten Bomberflotten geworden. Und als der Zweite Weltkrieg beendet war, waren die einst blühenden Werften fast nur noch Ruinen.
Von der »Stunde Null« zum Schiffbauboom
Die »Stunde Null« nach der deutschen Kapitulation war nicht das Ende des deutschen Schiffbaus. Allerdings sah das Potsdamer Abkommen die Demontage aller Industrieanlagen vor, die die Alliierten für entbehrlich, beziehungsweise für rüstungsrelevant hielten. Das traf auch die Werftindustrie. Vor allem bei den großen Werften setzten die Alliierten ihr Ziel rigoros um. In Kiel schloss die britische Besatzungsmacht umgehend die Germaniawerft und die Deutschen Werke, um sie zur späteren Demontage vorzubereiten. Sie bestanden zwar noch auf dem Papier weiter, durften aber keinen Schiffbau mehr betreiben. Nur die Howaldtswerke sollten als Reparaturbetrieb weiter aufrechterhalten bleiben.
Das war in erster Linie das Verdienst des kaufmännischen Direktors der Howaldtswerke in Kiel, Adolf Westphal. Er schaffte es mit großem Geschick, die britische Besatzungsmacht davon zu überzeugen, dass sie eine Reparaturwerft am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanal brauchten. Ihm ist es zu verdanken, dass sich der Aufstieg der Howaldtswerke in Kiel nach dem Krieg nahezu kometenhaft gestaltete und er ist neben Georg Howaldt und Heinrich Diederichsen eine der bedeutendsten Gestalten in der Geschichte der Werft. Westphal konnte verhindern, dass die Werft gesprengt werden sollte. Damit begann das Reparaturgeschäft. Von Kriegsende bis Ende 1947 hatte Westphal bereits 835 Schiffe repariert. Doch schnell ging es um größere Aufgaben. So baute die Werft verschiedene Schiffe um. Und als das Petersburger Abkommen den Schiffsneubau erlaubte, brachte es eine ganze Auftragswelle an die Förde: Bis Ende 1950 standen vier Fischdampfer, drei Fischereimotorschiffe, vier Frachtdampfer und sechs Motorfrachter in den Auftragsbüchern.
Der Neubau begann 1950 mit zwei Fischdampfern. Ein Jahr später standen bereits 21 Tanker, die vorwiegend norwegische Reeder bestellt hatten, im Auftragsbuch. In dieser Zeit zog Westphal einen ganz großen Fisch an Land, der für die Howaldtswerke lange Jahre ein treuer Kunde werden sollte: Aristoteles Onassis. Er ließ 1950 einen ausgediente T2-Tanker zum Walfangmutterschiff »Olympic Challenger« umbauen und eine kleine Flotte von Fangbooten aus alten kanadischen Korvetten gleich dazu.
Auch die Howaldtswerke in Hamburg kamen glimpflich davon. Verschont von der Demontage, die die Werft von Blohm & Voss so radikal betroffen hatte, dass sie erst 1954 wieder Schiffe bauen konnte, bekamen sie schon im Mai 1945 eine Betriebsgenehmigung von den Briten. Zwar lief das Reparaturgeschäft in Hamburg ziemlich schleppend an, weil die internationale Schifffahrt die Hansestadt noch mied. Dafür konnten die Howaldtswerke 1947 immerhin gleich drei der »Potsdam-Fischdampfer«, um die sich alle Werften rissen, in die Orderbücher als Neubauten schreiben.
Kiel und Hamburg trennen sich
Adolf Westphal arbeitete zielbewusst auf eine Trennung der beiden Betriebe hin. Das gelang ihm 1952 mithilfe der Bonner Beamten – denn letztlich waren die Howaldtswerke immer noch ein Staatsbetrieb – und einem Kunstgriff. Von da an gingen die Kieler und die Hamburger Howaldts unter den Namen »Kieler Howaldtswerke AG, Kiel« und »Howaldtswerke Hamburg AG« getrennte Wege. Allerdings war die Trennung nicht von Dauer, wie sich zeigen sollte.
Kaum hatte Adolf Westphal seine Kieler Schäfchen ins Trockene gebracht, macht er den nächsten Schritt. Er betrieb die Verschmelzung der Kieler Howaldtswerke mit den Deutschen Werken in Kiel und erreichte sie 1955. Damit war Westphal der König auf dem Kieler Ostufer und trug seinen Spitznamen »King Adolf« zu Recht.
Boomjahre und neue Konkurrenz
Die Zeiten für den Kieler Schiffbau waren gut. 1959 waren die Howaldtswerke Weltspitze: Mit 16 Schiffen und einer Gesamttonnage von etwa 400.000 dwt lieferten sie weltweit den größten Schiffsraum ab. In den Folgejahren bauten die Howaldtswerke in Kiel und Hamburg einen Tanker nach dem anderen, darunter 1954 den ersten »Supertanker« der Welt, die »Al Malik Al Saud Awal« für Onassis. Für den Griechen baute die Kieler Werft die Fregatte »Sormont« zur Luxusyacht »Christina« um. Ende der Fünfzigerjahre machten sich die Kieler Howaldtswerke einen Namen mit Fischereifabrikschiffen für die Sowjetunion. Zugleich wurden die Howaldtswerke nicht mehr von dem Bonner Finanzministerium beaufsichtigt, sondern gerieten unter die Ägide der bundeseigenen, privatwirtschaftlich geführten Salzgitter AG.
Inzwischen hatte sich die Schiffbauszene merklich verdüstert. Einige Länder, darunter auch EWG-Staaten, gewährten staatliche Subventionen, der Preisverfall auf dem internationalen Markt betrug bis zu 40 %, und die Überkapazitäten im internationalen Schiffbau drückten die Preise weiter. Vor allem Japan hatte in großem Stil begonnen, seine Werften zu subventionieren. Damit konnte die japanische Schiffbauindustrie Schiffe zu Dumpingpreisen anbieten.
Der Weg zu HDW
Angesichts der immer schwieriger werdenden Lage der Werften lag die Idee zu einer Werftenfusion geradezu in der Luft, und es kam 1968 zur Fusion der Kieler Howaldtswerke, der Howaldtswerke Hamburg und der Deutschen Werft. Die nun unter »Howaldtswerke-Deutsche Werft AG« firmierende Werft besetzte den dritten Platz auf der Weltrangliste der Werften und bot 22.000 Arbeitsplätze in Kiel und Hamburg. 1973 beteiligte sich das Land Schleswig-Holstein an dem Werftenverbund, denn HDW war bei Weitem der größte industrielle Arbeitgeber in Schleswig-Holstein.
Im gleichen Jahr fiel die Entscheidung, in Kiel ein Großdock für 500.000-t-Tanker zu bauen. Der Markt verlangte nicht nur immer mehr, sondern auch immer mehr größere Tanker und dafür reichten die Anlagen der HDW nicht aus.
Wieder schweres Wetter
Als das Dock drei Jahre später fertiggestellt war, kam der »Ölschock« und der Tankermarkt war zusammengebrochen. Alle Tankeraufträge, die HDW noch hatte, wurden storniert – wenigstens mit akzeptablen Ausgleichzahlungen. So wurde das Dock fertig gebaut und erlaubte später den Bau mehrerer großer Containerschiffe zur gleichen Zeit.
Um diese Zeit begann für den Schiffbau eine Durststrecke, die lange anhalten und zu Beginn der Achtzigerjahre in Europa zu einem regelrechten Werftensterben führen sollte. So musste auch HDW Fertigungskapazitäten mehrfach verringern und schließlich in den Achtzigerjahren den Werftstandort Hamburg vollkommen schließen und die drei Betriebe in Kiel auf den Standort Gaarden konzentrieren. 1987 übernahm HDW die notleidende Werft Nobiskrug und baute das dort begonnene Polarforschungsschiff »Polarstern« zu Ende.
Als HDW 1988 das 150. Jubiläum feiern konnte, war die Werft modernisiert und über den Berg. Sie machte gute Gewinne, mit denen sie sich wetterfest machte – unter anderem mit einem Modernisierungsprogramm »Werft 2000«, das den Betrieb Mitte der Neunzigerjahre grundlegend auf Vordermann gebracht hatte, und das sonst durchaus kritische »Handelsblatt« rühmte HDW als die modernste Werft Deutschlands. 1991 kaufte die zur Preussag fusionierte Salzgitter AG die Anteile des Landes Schleswig-Holstein zurück. Damit war die HDW kein Staatsbetrieb mehr.
Containerschiffe, Passagierschiffe,
U-Boote und ein Atomfrachter
Nichts hat die Handelsschifffahrt so sehr revolutioniert wie der Container. Um die Zeit der Fusion herum nahm die Containerschifffahrt ernst zu nehmende Dimensionen an. HDW war von Anfang an dabei. Ihren Ruf als exzellente Containerschiffswerft untermauerte die HDW mit einem Konzept, das den Containerschiffbau der Welt wesentlich befruchtete: das »Schiff der Zukunft«. Schiffbauliche Höhepunkte wurden die C 10- und C 11-Containerschiffe für die American President Lines und die sogenannten Open-Top-Containerschiffe für Norasia. Daneben baute HDW für die amerikanische Firma Dole die beiden größten Kühlcontainerschiffe der Welt.
Mit Fähren und Kreuzfahrtschiffen hat sich HDW immer wieder befasst. So baute die Werft in den frühen Sechzigerjahren mehrere Fähren für die Jahre-Linie, die Vogelfluglinie und schließlich für Superfast sowie einige Kreuzfahrtschiffe – zuletzt die »Deutschland«.
Den Ruf als U-Boot-Werft begründeten die Kieler Howaldtswerke Ende der Fünfzigerjahre, und zwar mit dem Umbau von drei Weltkrieg-II-U-Booten der wegweisenden U-Boot-Typen XXI und XXIII als Trainingsschiffe für die Bundesmarine. Besonders fruchtbar wurde die Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Lübeck, das später Bestandteil der HDW wurde. So entstanden zunächst zahlreiche Boote für die Bundesmarine und anschließend für den Export. Dies begründete auch eine gute Zusammenarbeit mit den Nordseewerken in Emden. Erfolgreich wurde vor allem die diesel-elektrische U-Boot-Klasse 209 in verschiedenen Versionen. Heute fahren über 65 Boote in 14 Marinen. Höhepunkt des deutschen Nachkriegs-U-Boot-Baus ist sicherlich die Einführung der Brennstoffzelle als außenluftunabhängiger Antrieb, der zu den U-Boot-Klassen 212A und 214 geführt hat. Der Export von U-Booten hat HDW den Ruf als weltweit beste U-Boot-Werft für nicht nukleare U-Boote eingebracht.
Eine technische Herausforderung ersten Ranges wurde der Bau des Atomforschungsschiffs »Otto Hahn«, das 1968 abgeliefert wurde. Der Frachter sollte die Möglichkeiten des Kernantriebs in der zivilen Schifffahrt untersuchen. Die Militärs hatte in ihren Marinen längst nuklear angetriebene Schiffe – vor allem U-Boote – im Einsatz. Im Zeichen der damaligen Euphorie über die zivile Nutzung der Kernenergie sollten Reaktoren nun auch auf Handelsschiffen eingesetzt werden. Die »Otto Hahn« wurde das dritte zivile Atomschiff der Welt.
Babcock und OEP: Turbulente Jahre
1999 verkaufte die Preussag die Mehrheit der HDW-Aktien an Babcock Borsig, da sie neue Konzernziele verfolgte, und überwies das Guthaben der HDW in Höhe von etwa 1 Mrd. DM nach Oberhausen in das »Cash Clearing« von Babcock. Unter der Regie des Oberhausener Konzerns übernahm HDW zuerst die schwedische Werft Kockums im Jahr 1999 und anschließend Hellenic Shipyards in Griechenland. Mit der Übernahme der beiden Werften war die Kieler HDW plötzlich eine internationale Schiffbaugruppe mit weit über 7.000 Mitarbeitern geworden, die im Herzen Europas ebenso tätig war wie im Norden und im Süden. Allerdings geriet Babcock selbst in Schwierigkeiten, sodass die HDW-Anteile in mehreren Zwischenschritten von einer Tochter der Bank One of America – One Equity Partners (OEP) – gehalten wurden.
2002 ging die Babcock in Insolvenz und für HDW begannen dramatische Jahre, obwohl es Babcock-Chef Klaus Lederer geschafft hatte, HDW aus dem Insolvenzstrudel herauszuhalten. Zugleich war der Handelsschiffbau in höchster Seenot, weil weltweite Überkapazitäten im Schiffbau die Preise ins Bodenlose hatten sinken lassen. Der Handelsschiffbau erhielt aber doch noch eine Chance zum Überleben, als es gelang, mehrere Containerschiffe unter Vertrag zu nehmen – dies allerdings mit einem Verzicht aller Mitarbeiter auf Sonderzahlungen und Bezahlung von Mehrarbeit.
Neustart im ThyssenKrupp-Verbund
Bereits 2001 hatte es Kontakte zu ThyssenKrupp gegeben, die eine gegenseitige Beteiligung zwischen HDW und den ThyssenKrupp-Werften beabsichtigten. Am 5. Januar 2005 vollzogen die HDW und die ThyssenKrupp-Werften ihre Hochzeit unter dem neuen Namen ThyssenKrupp Marine Systems. Damit war mit rund 9.000 Mitarbeitern in Deutschland, Schweden und Griechenland eine europäische Werftengruppe entstanden, die zahlreiche Vorteile bot und Grundlage für eine führende Position am Markt war.
Für die HDW fiel die Fusion mit einem weltweiten Orderboom für Containerschiffe zusammen, der den Überwasserschiffbau zunächst gut beschäftigte. Und auch im U-Boot-Bau kamen Aufträge für die neuen U-Boote vor allem aus dem Ausland herein. Nach den beiden spektakulären Megayachten »Al Salamah« und »Octopus« noch in der HDW-Zeit folgte die futuristische »A«, bei der sich die Kieler die Augen rieben, als sie zum ersten Mal über die Förde fuhr.
Die Lehman-Pleite im Jahr 2008 und die folgende Weltfinanzkrise änderten alles: Die Frachtraten brachen im Oktober innerhalb eines Monats um 90 % ein, und alle Containerschiffaufträge der 2005 für den Überwasserschiffbau gegründeten HDW-Gaarden wurden notleidend, weil die Banken nicht bereit waren, die Finanzierung der Auftraggeber sicherzustellen. So wurden im Februar 2009 innerhalb einer Woche vier Containerschiffe und sechs mittelgroße Yachten storniert und die Beschäftigung von zwei Jahren brach weg.
Eines aber hatte die Weltfinanzkrise deutlich gemacht: Der Handelsschiffbau in ganz Deutschland war letztlich nur noch ein Beschäftigungsmodell. Für TKMS war daher der zivile Schiffbau nicht mehr sinnvoll: Blohm + Voss, die Nordseewerke in Emden und die Werft Nobiskrug wurden verkauft, und bei den Rendsburgern, die inzwischen in arabischer Hand waren, fand die HDW-Gaarden als Abu Dhabi MAR Kiel einen neuen Heimathafen.
TKMS – ein kompetentes Systemhaus
Das 2005 vorgestellte Konzept des Werftenverbundes mit seiner breiten Schiffbaupalette, das unter günstigen Umständen entstanden war, konnte nicht lange bestehen bleiben. Dazu haben vor allem die Weltfinanzkrise mit ihren dramatischen Folgen und die ständige Vertragsbrüchigkeit der griechischen Regierung geführt. Dies hat alle Pläne durchkreuzt, die in guten Zeiten gemacht waren und dazu geführt, dass sich die Gruppe neu aufgestellt hat.
Aus einer Werftengruppe mit Standorten in Deutschland, Schweden und Griechenland, die alle Schiffbaubereiche – zivile und militärische – abdeckte, wurde mit einer tiefgreifenden Strukturreform ein reinrassiges Marine-Systemhaus, das U-Boote und Marine-Überwasserschiffe mit den modernsten Technologien anbietet. Auf dem Weg dahin wurden der zivile Schiffbau und auch die griechische Werft Hellenic Shipyards abgegeben.
Zum 1. Januar dieses Jahres wurden die Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH und Blohm + Voss Naval GmbH zur ThyssenKrupp Marine Systems GmbH mit Sitz in Kiel verschmolzen, die rund 4.500 besonders qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt. Die HDW führt heute als ThyssenKrupp Marine Systems die Geschäftsbe-
reiche HDW für U-Boote, Blohm + Voss Naval für Marine-Überwasserschiffe, Services für After-Sale-Aktivitäten sowie Kockums für U-Boote und Marine-Überwasserschiffe. Und so feiert die Traditionswerft neu strukturiert unter neuem Namen das 175. Jahr ihrer Geschichte.
Autor:
Dr. Jürgen Rohweder
Buchautor und Journalist, 24235 Stein
juergen.rohweder@t-online.de
Jürgen Rohweder