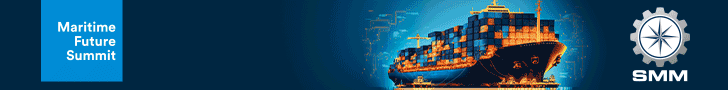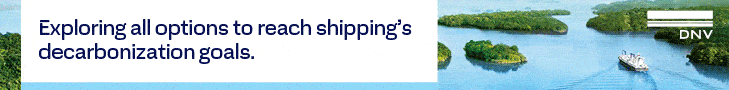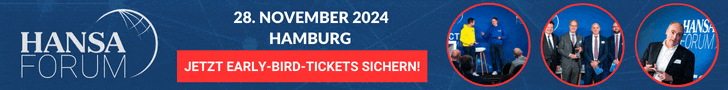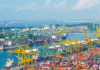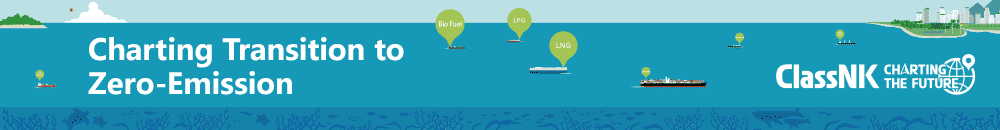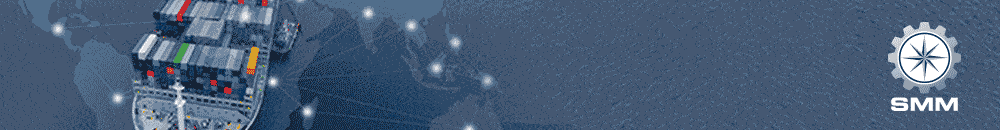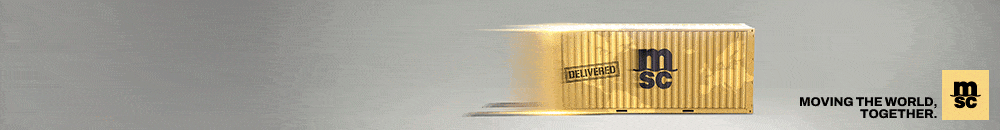Ein effektiver Schutz vor der weltweiten Piraterie benötigt den Austausch zwischen ziviler und militärischer Schifffahrt.
Die Gewässer vor Somalia sind sicherer geworden. Im Jahr 2013 wurden aus der Region lediglich 15 Angriffe gemeldet, im Jahr[ds_preview] davor waren es noch 75 und im Jahr 2011 sogar 237 gewesen. Pottengal Mukundan, Direktor des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB), das zur Internationalen Handelskammer (ICC) gehört und seit 1991 mit seinem Piracy Reporting Centre (PRC) alle Angriffe dokumentiert, sieht dies als positive Auswirkung der vielen Maßnahmen, die in den zurückliegenden Jahren zur Abwehr der Piraterie ergriffen wurden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die internationalen Marinestreitkräfte, an denen sich die Deutsche Marine beispielsweise im Rahmen der Mission Atalanta beteiligt. Aber auch die Ausrüstung der Schiffe nach den Empfehlungen der Best Management Practices (BMP3), der Einsatz von privaten Sicherheitskräften an Bord sowie der stabilisierende Einfluss der somalischen Zentralregierung wirken sich aus.
Anlass zur Entwarnung sieht Mukundan aber noch nicht: »Es ist unbedingt notwendig, dass die gemeinsamen internationalen Bemühungen fortgesetzt werden, um der somalischen Piraterie Herr zu werden. Jegliche Nachlässigkeit zum jetzigen Zeitpunkt könnte die Piraterieaktivitäten erneut anfachen«.
Aber auch in anderen Seegebieten müssen Schiffsbesatzungen mit Piratenüberfällen rechnen. Besonders hohe Risiken bestehen bei Routen durch die Gewässer Indonesiens, Bangladeschs, Malaysias und im Südchinesischen Meer. Vor Westafrika ist ein neuer Schwerpunkt der Piraterie im Golf von Guinea entstanden. Im Jahr 2012 wurden 58 Vorfälle gemeldet, darunter zehn Entführungen und 207 Geiselnahmen von Besatzungsmitgliedern.
Vor diesem Hintergrund ist Schutz vor Piraterie auch wieder das Thema während der MS&D, der internationalen Konferenz und Ausstellung über Maritime Sicherheit und Verteidigung am 10. September in Hamburg. Sie findet im Rahmen des SMM-Thementages »Sicherheit und Verteidigung« statt. »Auch in diesem Jahr sollen neue Möglichkeiten zum Schutz von Seewegen und Häfen erörtert werden«, sagt Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC). Zusammen mit dem Partner DVV/Griephan und dem Deutschen Maritimen Institut (DMI) richtet die HMC die Konferenz erneut aus. Insgesamt wird es zwei Panels geben. Das erste hat das Thema »Maritime Herausforderungen der Globalisierung«, das zweite trägt den Titel »Zukünftige maritime Fähigkeiten«.
Aussteller der MS&D zeigen die unterschiedlichen Konzepte, Schiffe gegen Piratenangriffe und Terrorattacken zu schützen. Beispielsweise das Unternehmen Marine Armor Systems, das ein passives Sicherheitssystem aus schusssicheren Platten vorstellt, die im Falle eines Angriffs auf Knopfdruck hochgefahren werden können. So schützen sie verletzliche Bereiche wie Brückenaufbauten, Tanks und Zitadellen.
Sicherheit durch Überwachung des Umfeldes soll das Monitoring System FOVEA ermöglichen. Laut Herstellerangaben erfasst es innerhalb weniger Sekunden ein 360°-Panorama mit einem Radius von mehreren Kilometern. Registrierte Bewegungen können automatisch verfolgt werden. Das soll die Lageeinschätzung für große Gebiete erleichtern. Das System soll sich für den Einsatz in Hafengebieten, an sicherheitsrelevanten Küstenabschnitten, auf Seefahrzeugen oder Offshoreanlagen eigenen.
Einsatzteams, die bewaffnet oder auch unbewaffnet Schiffe auf See und in Häfen sichern, hat die ZST Security Service Consulting and Technology GmbH. Zum Angebot gehört, individuelle Gefährdungspotenziale zu analysieren und daraus ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept zu entwickeln. Mit Training bereitet ZST die Besatzungen an Bord auf mögliche Gefahrensituationen vor.
Die MS&D wird neben anderen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Maritimen Institut (DMI) ausgerichtet, das seit mehr als 40 Jahren maritime Themen in der Öffentlichkeit vertritt. Der Schwerpunkt der Arbeit dieser Organisation hat sich mittlerweile von der Verteidigung auf See zu allgemeinen Themen der maritimen Sicherheit in Zeiten der Globalisierung verlagert. Die Deutsche Marine nutzt die Veranstaltung auch, um Reeder und Kapitäne auf ihre Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Beratung aufmerksam zu machen, damit sie gefährdete Gebiete sicherer passieren können. Es ist ein System, das auf freiwilliger Kooperation beruht und den Titel »Naval Cooperation and Guidance for Shipping« (NCAGS) trägt. Es warnt vor Minengefahren in Krisengebieten ebenso, wie es Informationen zur Anmeldung und Teilnahme an Konvoifahrten bei akuten Gefährdungen bietet.
Die NATO hat die NCAGS im Jahr 2013 neu aufgestellt. Sie soll die Bewegungsfreiheit der Seestreitkräfte sichern und dem Befehlshaber die notwendige Sachkenntnis aus der Handelsschifffahrt zur Verfügung stellen. Für die Deutsche Marine koordiniert das Dezernat Marineschifffahrtsleitung im Hamburger Stadtteil Iserbrook die Zusammenarbeit mit der NATO, den deutschen Behörden und den Unternehmen der Handelsflotte.
Dafür werden bereits bestehende militärische Organisationen, wie z. B. die NATO, und zivile Stellen, etwa Schifffahrtsbehörden, die sich mit maritimer und nautischer Sicherheit befassen, so vernetzt, dass ständiger Informationsaustausch und somit die Erstellung eines vollständigen nautischen Sicherheitslagebildes ermöglicht wird.
Um die notwendige Fachkenntnis aus der Handelsschifffahrt einbringen zu können, sind die meisten Mitarbeiter der Dienststelle Reservisten, die aus der Schifffahrtsbranche stammen und praktische Erfahrung aus der zivilen Schifffahrt mitbringen. Sie werden für Reserveübungen an die Dienststelle beordert. Damit erleichtern sie die Zusammenarbeit zwischen Marine und Handelsschifffahrt. Wie notwendig das gegenseitige Verständnis ist, zeigte das Jahr 1993. Während des Kosovokonfliktes sollten in einer gemeinsamen Operation der NATO und der Westeuropäischen Union (WEU) Wirtschaftssanktionen und ein Waffenembargo gegen die Bundesrepublik Jugoslawien durchgesetzt werden. Es galt also, in den Operationsgebieten Otranto und Montenegro, einschließlich der Hoheitsgewässer Albaniens und Montenegros, Handelsschiffe danach zu durchsuchen, ob sie entsprechende Konterbande an Bord hatten. Genannt wurde es Operation Sharp Guard. Bisher waren Marinesoldaten dafür ausgebildet, gegnerische Marineschiffe aufzuspüren, zu überwachen und gegebenenfalls zu bekämpfen. Nun mussten sie dazulernen.
Es war die Stunde von Reserveoffizieren wie Friedrich Fuchs, der seit seinem 15. Lebensjahr auf Handelsschiffen zur See fährt, sein Kapitänspatent hat und Lotse auf dem Nordostseekanal ist. Zugleich ist er Reserveoffizier der Deutschen Marine mit dem Dienstgrad Kapitän zur See der Reserve. Zur Motivation, sich bei der Marine zu engagieren, sagt er: »Es war bei einigen Reedereien für einen Schiffsoffizier in den 70er Jahren einfach üblich, auch eine freiwillige Reserveoffiziersausbildung zu durchlaufen. Obgleich wir als Seeleute ja vom Wehrdienst freigestellt waren.«
Die parallele Kenntnis der militärischen und der Handelsschifffahrt war für die neuen Herausforderungen eine gefragte Expertise. Und so war Fuchs von Anfang an dabei und arbeitete eng mit aktiven Offizieren zusammen. »Wir mussten neue Lehrgänge entwickeln. Dabei ging es zunächst um die Handelsschiff-Erkennung.« Die Vorgesetzten von Boardingsoldaten mussten also lernen, Tanker von Massengutschiffen, Stückgutfrachtern und RoRo-Schiffen zu unterscheiden. Inzwischen gibt es eine Boardingkompanie, die im Mai 2003 aufgestellt wurde und am Marinestützpunkt Nord in Eckernförde an der Ostsee stationiert ist. Sie untersteht dem Bataillon »Spezialisierte Einsatzkräfte Marine«, zu dem auch die Kampfschwimmer- und die Minentaucherkompanie gehören.
Angehörige der Boardingkompanie sind beispielsweise seit 2001 unter NATO-Führung an der Operation »Active Endeavour« im Mittelmeer zum Schutz des Seeverkehrs gegen terroristische Bedrohungen beteiligt. Seit September 2006 sind sie Bestandteil jener Besatzungen von Marineschiffen, die den Seeraum vor der Küste des Libanon überwachen und seit Dezember 2008 im Rahmen der Operation Atalanta auch auf den jeweils eingesetzten deutschen Marineschiffen zum Schutz vor Piraterie.
»Dann haben wir die Position eines Handelsschiffberaters eingeführt, eines Reserveoffiziers mit der Bezeichnung ECLO, also Embargo Control Liason Officer. Das ist derjenige, der mit dem Kapitän der zu kontrollierenden Schiffe spricht. Ein erfahrener Kapitän eines Handelsschiffes merkt innerhalb von Sekunden, ob der ihm gegenüber stehende Marineoffizier Ahnung hat oder nicht. Der braucht ihm nur den Stauplan verkehrt herum hinzulegen …«, erzählt Fuchs von den nächsten notwendigen Schritten.
Dabei machten er und die anderen beteiligten Reserveoffiziere interessante Erfahrungen. Es war nicht damit getan, Handelsschiffe zu erkennen und einzuordnen. Für Durchsuchungsaktionen war es notwendig, sich an Bord zurechtzufinden. Erste Übungen absolvierten die Boardingsoldaten auf Marinetendern. Doch im Vergleich zu Handelsschiffen ist ein Tender mit etwa 100m Länge ein kleines Schiff, auf dem man sich schnell zurechtfindet. Deshalb bezog die Ausbildung auch Fähren mit ein. Doch Handelsschiffe mit ihrer Typenvielfalt kann man nur an Bord selbst kennenlernen. Also fragte das Marinekommando in Hamburg bei Reedereiagenten an, ob sie bereit wären, Soldaten für Ausbildungszwecke während Hafenliegezeiten an Bord zu lassen. Sie reagierten unterschiedlich, als Hartwig Ross, der ebenfalls Reserveoffizier und Nautiker mit praktischer Erfahrung ist, seine Anfragen stellte. Doch Unternehmen, die einmal überzeugt wurden, geben danach gern wieder ihre Genehmigung.
Ein gutes Dutzend deutscher Reedereien unterstützt mittlerweile die Deutsche Marine, indem sie ihre Schiffe während der normalen Liegezeiten im Hafen für Übungen öffnet. So erleben die Soldaten zugleich den normalen Umschlagbetrieb und seine Abläufe. Nach Hamburg fahren die Mitglieder der Boardingkompanie nicht nur weil es der größte deutsche Hafen ist. Es ist darüber hinaus ein Universalumschlagplatz, in dem nicht nur Container, sondern auch Schüttgüter, rollende Ladung und Stück- sowie Schwergüter abgefertig werden. Entsprechend vielseitig sind die Schiffstypen. Die Reedereien haben ebenfalls ein Interesse an einer guten Ausbildung, denn zielstrebig vorgehende Soldaten bedeuten weniger Zeitverlust bei der Durchsuchungsaktion und Zeit ist Geld.
Bei den Übungsabschnitten in Hamburg schweben die Soldaten allerdings nicht mit Hubschraubern ein. Sie fahren stattdessen mit Bussen vor und gehen über die Gangway an Bord. Dabei stehen die gefleckte Tarnkleidung und auffällige rote Warnwesten mit reflektierenden Streifen im Widerspruch. Denn auch Marinesoldaten müssen bei ihrem Training im Hamburger Hafen die üblichen Sicherheitsvorschiften beachten. Und denen zufolge hat jeder auf Umschlaganlagen oder an Deck von Schiffen Warnwesten und Schutzhelme zu tragen. Zwischen Seemannshöft und O’Swaldkai will das gute Dutzend Männer Schiffstypen kennenlernen. Und zwar nicht von außen wie Touristen von einer Barkasse aus, sondern unmittelbar: mit dem Eindruck von Ecken und Winkeln, Rohrleitungen, engen Gängen, schmalen Treppen und mit aller Unübersichtlichkeit. Die Ausbilder zeigen beim Rundgang vom Maschinenraum bis zum Peildeck, an wie vielen Stellen sich auf einem solchen Schiff Menschen und Konterbande verstecken lassen.
»Auf einem Massengutschiff können sie einen kompletten Panzer mit einer Getreideladung zuschütten, das ist bei einer Kontrolle nur schwer zu entdecken«, sagt Ross, der die Übung leitet. Die Soldaten sind beeindruckt von den Dimensionen der Handelsschiffe, auch von den haushohen Antriebsmaschinen. Für die Soldaten sind diese Eindrücke wichtig. »Wenn sie diese erst während eines Einsatzes kennenlernen, sind sie abgelenkt und konzentrieren sich nicht auf ihre eigentliche Aufgabe«, erläutert Ross.
Auf der Kommandobrücke lernen die jungen Männer, wie man Schiffspläne liest, welche Schiffspapiere vorhanden sein müssen und welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann. Auch die Feinheiten von Stauplänen erklären die Ausbilder.
Dann wieder quäken Handfunkgeräte. Die Soldaten nutzen den Aufenthalt an Bord, um zu testen, wo der Schiffsstahl Funklöcher verursacht. Denn eine gestörte Kommunikation während eines Einsatzes kann gefährlich sein. Zwischendurch ermuntern die Ausbilder die Soldaten immer wieder, den Kontakt zu den Mannschaften zu suchen und sie auch zu ihrem Alltag an Bord zu befragen. Obgleich alle englisch sprechen, erfahren sie so, wie unterschiedlich dies von Besatzungen aus verschiedenen Nationen ausgesprochen wird. Die Seeleute empfangen die deutschen Soldaten freundlich und keinesfalls als Eindringlinge. Daran haben sie auch selbst ein Interesse. Denn wenn an Bord alles korrekt ist, beschleunigt Offenheit die Kontrolle und das Schiff kann ohne Zeit- und damit auch ohne Geldverlust seine Fahrt fortsetzen.
Es kann auch sein, dass Leben und Freiheit der Seeleute selbst einmal vom Einsatz der Soldaten abhängen. Denn in Fällen von Nothilfe gehen die Mariner auch mit Waffengewalt gegen Terroristen oder Piraten vor und befreien Geiseln, obgleich dies laut der deutschen Gesetzeslage eigentlich eine Aufgabe für Spezialkräfte der Polizei ist. m
Eigel Wiese