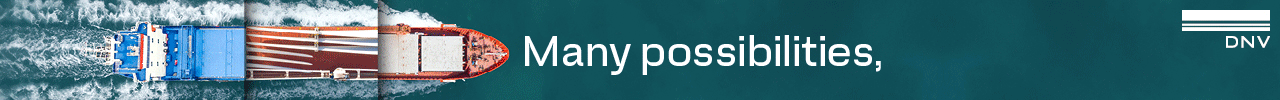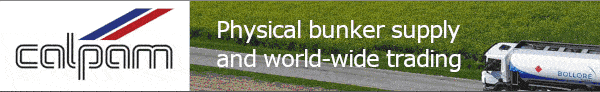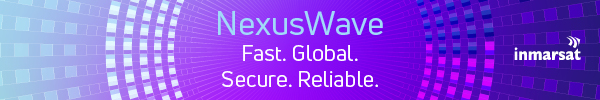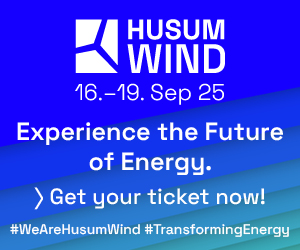Paywall
 Der »Polar Code« auf dem Prüfstand
Der »Polar Code« auf dem Prüfstand

Angesichts immer besserer Voraussetzungen für arktische Transporte rücken der Polar Code der IMO – inklusive möglicher Anpassungen – sowie digitale Routing- und Performance-Tools zunehmend in den Fokus der Schifffahrt. V…
Verwandte Themen