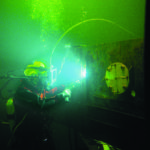Wenn auf den Weiten der Meere ein Schiff havariert, sind die Spezialisten von Svitzer Salvage meist mit unter den ersten vor Ort. Neben Schnelligkeit zählt bei der Bergung Grips: Statt auf Kraft allein setzen die Helfer des Unternehmens auf Hebelgesetze und Auftriebsprinzip. Über die eigenen Regeln der Branche berichtet Nikos Späth
Die Woche am Westerduinweg 3 beginnt ruhig. Es ist Montagnachmittag, die Mitarbeiter konnten pünktlich um 12 Uhr ihr »Middagmaal[ds_preview]« einnehmen, und es sieht nicht so aus, als müsste heute jemand die Nacht durcharbeiten. Relative Entspannung herrscht also in der Zentrale von Svitzer Salvage im niederländischen IJmuiden, einem Ortsteil der Gemeinde Velsen in der Provinz Nordholland. Durch die Glasfronten fällt der Blick aufs Wasser in den alten Haringhaven, der noch heute einer der größten Umschlagplätze in Europa für gefrorenen Fisch ist. Nun, das Panorama ist nicht unbedingt schön, aber das Thema passt – maritim eben.
In dem 30.500-Seelen-Ort, freilich, ist selten Rummel angesagt, dafür muss man nach Amsterdam fahren, etwa mit dem Schnellboot in einer Dreiviertelstunde durch den Nordseekanal. Trotzdem kann es im Westerduinweg 3 zuweilen ziemlich hektisch werden. Immer dann, nämlich, wenn irgendwo auf den Weltmeeren ein Unglück passiert. Svitzer Salvage gehört zu den größten Bergungsunternehmen auf dem Globus und bezeichnet sich bei Notfalleinsätzen (»emergency response«) als Weltmarktführer. Ob beim brennenden Containerschiff »Hyundai Fortune« im Golf von Jemen (2006), dem gekenterten Autotransporter »Repubblica di Genova« im Hafen von Antwerpen (2007), der explodierten Ölplattform »West Atlas« vor Westaustralien (2009) oder dem vor einem Jahr vor der neuseeländischen Küste auf ein Riff gelaufenen Containerschiff »Rena« – jedes Mal waren Svitzer-Experten am Unglücksort, um in höchster Not zu helfen.
Seeunglücke sind Alltag
70 bis 80 Havarien bearbeitet das zu A.P. Møller-Maersk gehörende Unternehmen im Schnitt pro Jahr. Zwei Drittel sind in zwei bis vier Wochen erledigt – die restlichen schweren Fälle dauern Monate, manchmal auch länger als ein Jahr. Allein die größeren Operationen nehmen in der Broschüre mit dem Track Record der Jahre 1995 bis 2012 – man könnte auch »Referenzliste« dazu sagen – insgesamt 82 Seiten ein.
Während die meisten Havarien kaum publik werden, machten die Unglücke des Mitte Juli im Atlantik in Brand geratenen Postpanamax-Containerschiffs »MSC Flaminia«, des Kreuzfahrtschiffs »Costa Concordia« und der »Rena« in den vergangenen zwölf Monaten Schlagzeilen in aller Welt. Sie haben gezeigt, dass Unfälle auf See trotz etlicher technischer Hilfsmittel Alltag sind. Seit vergangenem Jahr ist sogar wieder »ein Aufwärtstrend in der Frequenz der Schäden als auch in der Schadenhöhe zu verzeichnen«, sagt Rüdiger Hansel vom Hamburger Versicherungsmakler Junge & Co. Eine Vielzahl von Grundberührungen und Kollisionen habe zu »sehr hohen Schadenbelastungen« geführt, so der Versicherungsexperte.
Zu dieser Negativbilanz haben zwei Männer ganz besonders beigetragen: Nachdem »Rena«-Kapitän Mauro Balomaga am Morgen des 5. Oktober 2011 sein 3.032-TEU-Schiff auf das unweit der Hafenstadt Tauranga gelegene Astrolabe-Riff setzte, weil er eigenmächtig eine Abkürzung nahm und ein Radarwarnsignal ignorierte, tat es ihm Francesco Schettino mit der »Costa Concordia« am 13. Januar dieses Jahres vor der italienischen Insel Giglio an der Felsgruppe »Le Scole« gleich. Die genauen Ursachen für Schettinos riskantes Manöver werden vor Gericht ermittelt – fest steht aber schon, dass die Bergung des 114.000-BRZ-Liners die bislang größte und vermutlich auch teuerste der Geschichte wird. 300 Mio. € soll es kosten und rund ein Jahr dauern, den 290 m langen Schiffskörper im Ganzen zu bergen, ihn abzutransportieren und dann zu zerlegen. Die Kostenuhr für Bergung und Aufräumarbeiten der 236 m langen »Rena« (siehe Fallbeispiel auf S. 73) wird nach Schätzungen der Reederei Costamare und ihren Versicherern bei Beendigung immerhin bei knapp 200 Mio. € stehen. Dafür ist dem zu sieben Monaten Haft verurteilten Kapitän ein Rekord schon sicher: In der malerischen Bay of Plenty verursachte er die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte Neuseelands. 350 t ausgelaufenes Öl ließen mehrere Tausend Seevögel verenden.
Ständige Alarmbereitschaft
Die beiden Großhavarien lösten damals auch bei Svitzer Alarmbereitschaft aus. Es dauert nie lange, bis solche Meldungen in IJmuiden eintreffen. Sie können aus den weltweiten Maersk-Büros kommen, von Maklern, manchmal aus der Presse oder Internet-Blogs. Diese Informationen müssen zunächst überprüft werden, bevor ein möglicher Einsatz starten kann. Oft ist es auch der betroffene Kaskoversicherer oder P&I-Club, der einen Rundruf startet, und im besten Fall sind es Eigner oder Schiffsmanager direkt: Diese sollten laut ihrem Emergency Response Plan (ERP) unter anderem Experten wie die Salvage Association (Braemar) oder das Lloyd’s Agency Network alarmieren, um schnell Hilfe von erfahrenen Bergungsunternehmen zu bekommen.
Bei der »Rena« kam Svitzer dann auch zum Zuge. Da parallel aber noch drei andere Projekte liefen, sah man in IJmuiden im Januar keine Kapazitäten, sich mit einer Mega-Havarie wie jener der »Costa Concordia« zu beschäftigten. So ließ man Smit den Vorrang für die Ersthilfe und das Abpumpen des Öls, während der Multi-Millionen-Bergungsauftrag an Titan Salvage – eine Tochterfirma der US-Gruppe Crowley Maritime – und die italienische Micoperi ging. Sechs Unternehmen hatten hierfür geboten.
Ist man nicht gerade total ausgelastet, bricht aber auch bei Svitzer bei jedem bekannt gewordenen Unfall auf See hektische Betriebsamkeit aus. Weltweit innerhalb von 24 Stunden vor Ort zu sein, lautet Svitzers Ziel. Dies gelang bei der »Rena« zumindest einer Vorhut, während das ganze Einsatzteam – bestehend aus dem leitenden »Salvage Master« (Bergungsinspekteur), einem Bergungsoffizier, Schiffbauingenieuren, Tauchern und Technikern – nur 36 Stunden nach dem Notruf komplett an Bord war. Dazu wird zuweilen ein Jet gechartert, der die Rettungscrew zum Einsatzgebiet bringt.
Wettrennen zum Unglücksort
Um die Distanzen zu verkürzen, befinden sich sogenannte »Strike Teams« neben dem Hauptquartier in IJmuiden auch in Göteborg, Miami, Hull, Rio de Janeiro, Sydney, Singapur und Kapstadt. Hier unterhält Svitzer Lagerhäuser mit Ausrüstung fürs Tauchen, Schleppen, Schneiden und Schweißen. Die Gerätschaften sind von der Größe her so standardisiert, dass sie in Luftfrachtcontainern verschickt werden können.
Die führenden Unternehmen der Bergungsbranche – neben Svitzer allen voran die niederländischen Kollegen von Smit, Mammoet und Multraship, die griechischen Five Oceans Salvage und Tsavliris sowie T&T Bisso, Titan Salvage und Resolve Marine aus den USA – schicken oft zeitgleich ihre Teams an den Unglücksort, um zu helfen und sich einen Überblick zu verschaffen.
Eigner und Schiffsmanager begrüßen die Ersthilfe verständlicherweise und lassen die Bergungskräfte in der Regel an Bord. Bei extremen Notlagen wie Feuer ist der Zeitfaktor entscheidend. Wer mit einem Feuerlöschboot in der Nähe ist, wird natürlich sofort bei der Brandbekämpfung helfen und geht damit automatisch ein Vertragsverhältnis mit der Reederei des Havaristen ein. Ist die Lage des Schiffs dagegen stabil, etwa wenn es auf Grund sitzt, können ein paar Tage vergehen, bevor ein spezifischer Bergungsauftrag erteilt wird – daher finden sich die Spezialisten in Stand-by-Haltung ein.
Manchmal treffen sich die Rettungsteams der verschiedenen Unternehmen schon bei der Anreise – man kennt und schätzt sich, konkurriert aber sportlich um Aufträge. Da es aus Kapazitätsgründen oft zu fallbezogenen Kooperationen kommt, wie im Fall der »Rena« zwischen Svitzer und Smit, ist ein fairer Umgang in der Bergungsbranche Usus. »Etwas Familiensinn gehört schon dazu«, sagt Bauke van Laar, der bei Svitzer Salvage von IJmuiden aus die Rettungscrews betreut, quasi als »Mädchen für alles«. Vor allem hat der 48-Jährige eine Menge Papierkram zu erledigen: Er muss dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter stets aktuelle medizinische, nautische und tauchspezifische Zertifikate haben. In regelmäßigen Abständen müssen diese erneuert werden.
Bergungsjob als Berufung
An diesem ruhigen Montagnachmittag in der Firmenzentrale beschreibt van Laar das Besondere an der Bergungsbranche: »Wenn Du morgens um 8 Uhr ins Büro gehst, weißt Du nie, was Dich am Tag erwarten könnte.« Wo andere nach Feierabend um 17 Uhr den abendlichen Kinobesuch planen können, müssen die Svitzer-Angestellten stets auf eine Krisensituation vorbereitet sein. Die perfekte Work-Life-Balance ist so nicht immer gegeben, gerade für die »Außendienstler«. Durch wochenlange, vorher nicht absehbare Einsätze an den entferntesten Orten der Welt ist die Freizeit- und Urlaubsplanung schwierig, Belastungen des Privat- und Familienlebens kommen vor. »Es ist eben ein anderer Lebensstil«, weiß van Laar. Daher sei die Arbeit in der Bergungsbranche nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung: »Unsere Leute wollen einfach helfen. Für sie ist es eine Frage der Ehre, dass es beispielsweise nicht zu einer Ölverschmutzung kommt.«
Im Einsatz geht es aber nicht nur um Umweltschäden großen Ausmaßes und enorme wirtschaftliche Verluste, die es zu verhüten gilt, sondern nicht selten um Leben und Tod – etwa bei Bränden auf Schiffen oder Bohrinseln. Das Helfer-Ethos greift auch hier, wobei sich die Svitzer-Leute selbst in latente Gefahr begeben. Diese ist ein ständiger Begleiter, auch in vermeintlich stabilen Bergungssituationen. Ein mögliches Sinken des Schiffes, Explosionen und Feuer, die Freisetzung von Giftstoffen, große Höhen oder Tiefen, schwere See – ein ängstlicher Typ darf man nicht sein, wenn man für ein Unternehmen wie Svitzer arbeitet. »Deshalb sind das schon spezielle Charaktere bei uns«, sagt van Laar. »Viele waren zuvor Tiefseetaucher, etwa bei der Marine.«
Einen Todesfall hat Svitzer in den vergangenen Jahrzehnten glücklicherweise nicht betrauern müssen. Dennoch ist die potenzielle Gefahr ein Grund, warum manche diese Arbeit wieder aufgeben, häufig aus Rücksicht gegenüber der Familie. »Es ist schwer, die richtigen Leute für diesen Job zu bekommen«, sagt van Laar. Dabei ist der Beruf abwechslungsreich, man kommt in der Welt herum und verdient ziemlich gut. »Unsere Konkurrenten fischen in demselben kleinen Markt, entsprechend ordentlich sind die Gehälter.«
Ein Mann für alle Fälle
Der Mann, der das Geld reinholt, um Spezialisten, Equipment und Schiffe zu bezahlen, ist Kapitän Hendrik Land. Als Head of Emergency Response ist es seine Aufgabe, die Dienstleistungen von Svitzer Salvage zu vermarkten. Erst einmal braucht er einen Überblick über die Lage, wenn ein Schiff verunglückt ist. Auch deswegen wird meist eine Vorhut geschickt, um Informationen aus erster Hand zu haben. Dann muss Kapitän Land in kurzer Zeit ein Angebot mit einer Bergungsmethode machen, die effektiv ist, vergleichsweise kostengünstig und logistisch gut umsetzbar. Das kann er nur, weil er schon seit 1981 bei Svitzer Salvage ist, das damals noch das rein niederländische Bureau Wijsmuller war, und sowohl operativ als auch kommerziell nahezu alle Positionen innehatte. Trotz seiner unauffälligen äußeren Erscheinung – Kapitän Land könnte auch als Bankdirektor durchgehen – heißt es über den 52-Jährigen sprichwörtlich, er sei mit allen Wassern gewaschen. Ohne ihn wäre die Firma nicht, wie sie ist, sagt man in IJmuiden.
Lands Job ist nicht leicht: Nur wenige Reeder haben Vor- bzw. Exklusivverträge mit Bergungsunternehmen geschlossen. Deshalb setzt sich um eine Havarie oft ein regelrechter Wettbewerb in Gang. Persönliche Kontakte zu den Reedern helfen hier – auch Bergung ist ein »people-related business«, wie es neudeutsch heißt. Sprach- und Kulturkenntnisse spielen ebenfalls eine große Rolle. Die Wahl des Bergungsunternehmens entscheidet der Reeder indes nicht allein: P&I-Club, Kaskoversicherung und natürlich der Eigner, so er nicht selbst der Bereederer ist, wollen an dem Prozess beteiligt werden. »Das Interessante ist«, sagt Kapitän Land, »kein Fall ist wie der andere. Wie gut man auch plant, man muss seine Planungen immer wieder dem Unvorhergesehenen anpassen.« Zwar gibt es vergleichbare Notlagen: Ein Schiff ist auf Grund gelaufen, hat Seitenlage, ist bei einer Kollision beschädigt worden, brennt nach einer Explosion oder treibt steuerlos auf dem Ozean umher. Aber die Rahmenbedingungen sind nie dieselben. Schiffsgrößen und -typen unterscheiden sich wie auch Einsatzorte, See- und Wetterbedingungen und vor allem Beteiligte und Betroffene: Schiffseigner, Bereederer, Makler, Spediteure, Versicherer, Hafenbehörden, Küstenwache oder die Presse haben jeweils eigene Interessen, die im Bergungsverfahren berücksichtigt werden wollen. Auch gibt es ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen an einen Dienstleister wie Svitzer Salvage: von der Stabilisierung und dem Abschleppen des Schiffs, der Löschung der Fracht über das Abpumpen von Bunker bis hin zur Wrackentfernung.
Kein Erfolg, keine Bezahlung!
Äußerst komplex sind zudem die vertraglichen Grundlagen in der Bergungsbranche. Wie in der Schifffahrt üblich, kommt keine Seite ohne Juristen aus – auch Svitzer Salvage nicht. Im akuten Notfall, freilich, ist keine Zeit zu verlieren. Lange Vertragsverhandlungen finden daher nicht statt. Brennt ein Schiff oder droht es zu sinken, wird fast immer eine sogenannte Lloyd’s Open Form (LOF) ausgestellt. Diesen nur eine Seite umfassenden Mustervertrag gibt es seit mehr als 100 Jahren, wobei das Grundprinzip schon in römischen Zeiten verbreitet war. Danach muss der Bergungsdienstleister nach bestem Wissen und Gewissen alles in seiner Macht stehende tun (»best endeavours«) und wird nach Komplexität, Aufwand und vor allem Erfolg entlohnt. Die simple Kernaussage lautet: »no cure, no pay«. Kein Erfolg, keine Bezahlung! Ein LOF-Vertrag kann auch mündlich oder per Funk vom Kapitän bestätigt und nachträglich verschriftlicht werden.
Der konkrete Bergelohn auf Basis der Lloyd’s Open Form wird erst dann festgesetzt, wenn die Notlage behoben wurde. Das übernehmen entweder die Vertragsparteien selbst oder Londoner Schiedsgerichte. Vom Zeitpunkt des Einsatzbeginns bis zum Geldeingang vergehen indes nicht selten ein bis zwei Jahre – da der Helfer in finanzielle Vorleistung geht, brauchen Unternehmen wie Svitzer stets Reserven auf dem Firmenkonto.
Zusätzlich zum LOF kann auch eine sogenannte Scopic-Regel (»special compensation«) zur Anwendung kommen. Kosten für eingesetzte Schiffe, Ausrüstung und Mitarbeiter sollen so abgesichert werden, selbst wenn die Bergung nicht zum erwünschten Erfolg führt – oder aber wenn die Kosten der Bergungsfirma über dem Wert des geborgenen Schiffes und seiner Ladung liegen.
Entstanden ist die Scopic-Regel, nachdem Bergungsunternehmen bei Tankerunglücken, insbesondere seit den 1970er Jahren, nach dem LOF-Prinzip leer ausgingen, weil das Schiff unrettbar war, sie aber eine größere Ölpest verhinderten. So wird heute auch das Eindämmen von Umweltschäden mit Sonderzahlungen nach Scopic honoriert. Der Verband der Bergungsindustrie, die International Salvage Union (ISU), hat jüngst eine noch weitergehende, spezielle Kompensation für »environmental salvage« vorgeschlagen.
Geht es nicht um Nothilfe oder ist diese bereits beendet, kommen andere Vertragswerke ins Spiel. So sind vor allem Wrackbergungen längerfristige Projekte, die gesondert ausgeschrieben werden. Zuvor haben die Versicherer das Schiff häufig bereits offiziell als Wrack (CTL = »constructive total loss«) deklariert. Ausgehandelt wird dann meist ein fixer Gesamtpreis für die Bergung (»lump sum price«), insbesondere bei stabilen und vorhersagbaren Bergungsbedingungen. Etabliert sind die Vertragswerke »ISU Salvcon 2005« und »Bimco Wreckstage«. Die Raten des Bergegelds fließen nach bestimmten Fortschritten und können nicht mehr vom Auftraggeber zurückgefordert werden, selbst wenn die Bergung misslingen sollte.
Anders ist dies bei einer Abmachung nach »Bimco Wreckfixed«: Das vereinbarte Bergegeld fließt, wie der Name schon sagt, nur bei der erfolgreichen Entfernung des Wracks, ähnlich der LOF-Bestimmung »no cure, no pay«. Eine weitere Möglichkeit ist ein Bimco-Vertrag (»Bimco Wreckhire«), in dem die Bezahlung nach fixen Tagesraten geregelt wird, die regelmäßig in Rechnung gestellt werden. Beim erfolgreichen Abschluss der Bergung kann noch ein Bonus hinzukommen, der auch abhängig von der Komplexität des Auftrags ist.
Schiffbaukenntnisse gefragt
Die unterschiedlichen Vertragsarten zeigen, wie genau die Berger wissen müssen, worauf sie sich einlassen, wollen sie am Ende nicht draufzahlen. Hier übernehmen Schiffbauingenieure eine wichtige Rolle, sind ihre Kenntnisse über den Zustand und das mögliche Verhalten eines Havaristen für die Wahl der Bergungsmethode, den genauen Ablauf und schließlich die gesamten Kosten doch von entscheidender Bedeutung. Ein Schiffbauer ist daher schon Teil der Vorhut und stets als einer der ersten auf dem Schiff.
»Wir spielen Detektiv an Bord«, beschreibt Rienk de Boer seine Aufgabe. Jeden Tag, bei Wind und Wetter, ist er auf dem havarierten Schiff, um dessen Verhalten zu dokumentieren: Tiefgang, Neigung, Rollbewegungen und vieles mehr. Die gesammelten Informationen schickt er nach IJmuiden, wo seine Kollegen sie gemeinsam mit den Grunddaten des Schiffes, geologischen Aufzeichnungen und Wetterinformation in ein Computermodell fließen lassen, das bereits nach zwei bis drei Tagen steht.
De Boer, ein Endzwanziger, dem man die Abenteuerlust im jugendlichen Gesicht nicht ansieht, war schon auf der abgebrannten Bohrinsel »West Atlas« dabei und mehrfach auf der »Rena«. Es ist sein erster Job nach Abschluss des Studiums – und die Wahl für Svitzer Salvage hat er nicht bereut. Augenscheinlich jettet er gern um die Welt.
Von seinen Einsätzen zeugen spektakuläre Fotos, die in Großformat an den Wänden im heimischen Bürogebäude hängen: Man sieht hier Rauchwolken, deformierten Stahl, ein Schiff mit extremer Schlagseite, auf dem Menschen arbeiten, und bunte Container, die wie Lego-Bauklötze herumgewirbelt wurden. Es ist eine irritierende Ästhetik, die von den Bildern ausgeht.
Reise ins Ungewisse
Acht Wochen am Stück dauern die Außeneinsätze, mit nur wenigen Ruhepausen, denn das Schiff ist im Schichtbetrieb rund um die Uhr besetzt. Deshalb wechselt sich de Boer bei seinen Dienstreisen auf See mit seinem Schiffbaukollegen Boaz Cochavi ab. Schließlich sind die lange Abwesenheit von zu Hause und die kräftezehrende Arbeit eine enorme Belastung, bei aller Abwechslung und Abenteuer. Immerhin: »Die Familie hat sich an meine häufigen Reisen gewöhnt«, tröstet sich Cochavi, 46, »zum Glück kennen die Kinder es auch gar nicht anders.«
Jeder Trip ist einer ins Ungewisse. Wenn das Bergungsteam an Bord kommt, sind viele Konditionen noch nicht bekannt. Daher lebt ein Schiffbauingenieur bei Svitzer sicher gefährlicher als auf einer Werft. So könnten etwa gesundheitsschädliche Gase auftreten – deshalb gehört zur Erstausrüstung stets ein Gasdetektor. Eine Rettungsweste ist ohnehin vonnöten. »Sollten wir auf einem Schiff sein, das plötzlich zu sinken beginnt«, sagt de Boer, »hilft nur noch springen und schwimmen.« Angst habe er trotzdem nicht: Dank der erfahrenen Salvage Master und des intensiven Trainings sei maximale Sicherheit garantiert.
Ohne Taucher geht gar nichts
Mindestens so viel Ernstfallschulung haben die Taucher, deren Arbeit zweifellos am gefährlichsten ist. So lauern auf hoher See starke Strömungen. Auch wenn sie in ein Wrack hineintauchen, ist höchste Vorsicht angesagt. Deshalb arbeiten sie immer in Teams von vier bis fünf Mann: ein Taucher mit Buddy, ein Back-up-Kollege über Wasser, einer, der Tauchgang und Ausrüstung überwacht, und ein weiterer, der sich um die Dekompressionskammer kümmert.
Rund die Hälfte der 30 Taucher aus den Niederlanden, Singapur und Südafrika, die für Svitzer arbeiten, ist freiberuflich im Einsatz. Sie werden je nach Gefahrengrad, Einsatzort und -dauer bezahlt. Sie müssen in ihrer Tauchmontur akkurat Stahl schneiden und verschweißen, schwere Taue am Rumpf befestigen können, Wrack- und Ladungsteile orten – und all das stets in einem engen Zeitfenster.
Indem sie Grundberührungen und Unterwasserverhalten des Schiffs in Augenschein nehmen, versorgen sie die Ingenieure überdies mit wertvollen Erkenntnissen, anhand derer das Schiffsverhalten modelliert werden kann. Neben Seekarten, dem Echolot, Unterwasserscans via Sonar oder dem Einsatz eines ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) sind die Taucher somit eine wichtige Informationsquelle.
Wer gibt den Ton an?
Bei ihren Einsätzen versuchen die Bergungsspezialisten, eng mit der Crew zusammenzuarbeiten, so diese denn noch an Bord ist. Schließlich kennt die Mannschaft ihr Schiff am besten. Es kann aber zu Reibungen kommen, etwa wenn der Kapitän des Havaristen sich bei einer unterschiedlichen Sichtweise auf die Situation nicht vom Gegenteil überzeugen lässt. Je nach Vertragsform kann er überstimmt werden. Hendrik Land gibt ein Beispiel: »Stellen Sie sich vor, ein Schiff ist auf Grund gelaufen, aber es schwankt hin und her und reibt sich immer wieder an scharfkantigen Felsen, dann haben wir den Effekt eines Dosenöffners«, beschreibt er bildlich. »Was machen wir also? Wir pumpen Ballastwasser an Bord, um das Schiff zu stabilisieren. In so einer Situation hat uns ein Kapitän schon einmal für verrückt erklärt. Schließlich sei unser Job doch, das Schiff wieder frei zu bekommen, anstatt es noch mehr auf den Meeresgrund zu drücken.«
Wer in dem skizzierten Fall recht hatte, ist offenkundig – so wie die Svitzer-Leute fast immer recht haben. Sonst hätten sie sich kaum so lange an der Spitze der Bergungsbranche gehalten.
Ihr Leitsatz laute »think smart«, erklärt Kapitän Land. Will heißen: Bevor schweres und teures Gerät herangeschafft werde, solle erst einmal der Kopf eingesetzt werden. Natürlich hat Hendrik Land, der Mann für alle Fälle, gleich ein Beispiel parat.
Im Juni 2011 kenterte das Containerfeederschiff »Deneb« (508 TEU) beim Beladen im Hafen von Algeciras und legte sich komplett auf Steuerbord. Zunächst wurden die Container entladen, der Maschinenraum und die Ladeluken ausgepumpt. Svitzer ließ vier hafeneigene Krane mobilisieren, deren Seile unter dem Rumpf durchgeführt und an genau berechneten Punkten befestigt wurden. Mithilfe von gemeinsamer Zug-, Hebel- und Auftriebskraft stellte sich die »Deneb« wieder senkrecht auf. Während er erzählt, greift das Svitzer-Urgestein spontan zu Stift und Papier und malt eine Skizze, wie die Bergung vonstatten ging. Dabei wird deutlich: Wo ein Wettbewerber von vornherein die pure Hubkraft eigener Schwimmkrane genutzt hätte, auf die Svitzer aus Kostengründen verzichtet, setzt man in IJmuiden auf Mechanik und Mathematik. »Wir verstehen uns mehr als die Archimedes-Jungs«, sagt Hendrik Land schmunzelnd, »während andere eher Newton-Fans sind.«
Nikos Späth