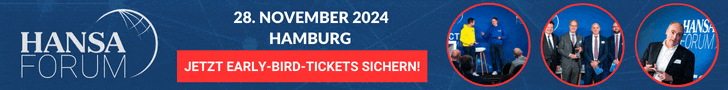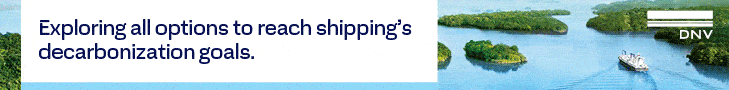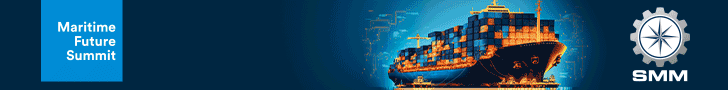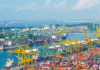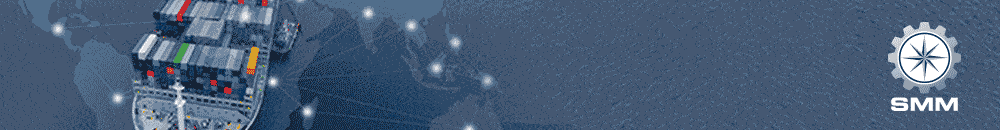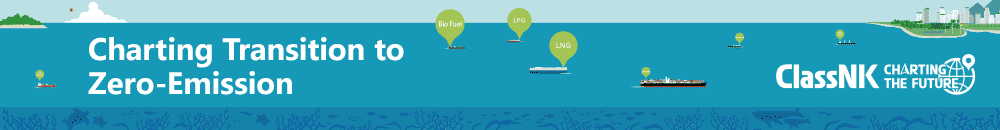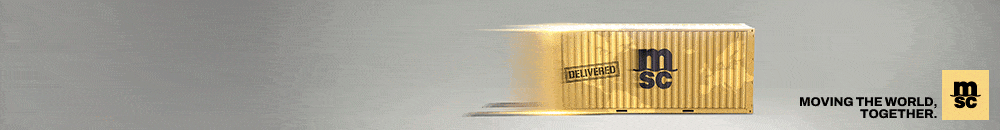Die jüngsten Änderungen am Vorschlag für das EU-Emissionshandelssystem für den Seeverkehr erhöhen – wenn sie angenommen werden – den Druck auf die maritime Industrie, auf sauberere Kraftstoffe umzusteigen.[ds_preview]
Am 14. Januar 2022 veröffentlichte der Berichterstatter des Europäischen Parlaments, Peter Liese, seinen Berichtsentwurf über einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über das Emissionshandelssystem (ETS), der Teil des am 14. Juli 2021 veröffentlichten EU-Klima- und Energiereformpakets »Fit for 55« ist. Der Berichtsentwurf enthält eine Reihe ehrgeiziger Änderungen am Emissionshandel für den maritimen Sektor.
Nick Walker und Valentina Keys, Partner bzw. Senior Associate der maritimen Anwaltskanzlei Watson Farley & Williams (WFW), haben die neuen Empfehlungen für das maritime ETS unter die Lupe genommen. Während das Grundprinzip des Vorschlags für ein maritimes Emissionshandelssystem auf dem Verursacherprinzip basiert, enthält der Berichtsentwurf eine Reihe bedeutender Änderungen der Definitionen, des Anwendungsbereichs, der Einführungszeiträume und der Schwellenwerte, die vorgeschlagen werden.
Vollständiges Reporting von Emissionen soll 2025 beginnen
Die Schifffahrtsunternehmen müssten dem Vorschlag zufolge 100 % ihrer geprüften Emissionszertifikate ein Jahr früher als ursprünglich vorgeschlagen abgeben. Begründet wird diese Änderung damit, dass eine kürzere Einführungsphase indirekt die Zahl der für andere Branchen verfügbaren Zertifikate erhöht. Anstelle der ursprünglich vorgeschlagenen Berichterstattung über 20 % der geprüften Emissionen im Jahr 2023, 45 % im Jahr 2024 und 70 % im Jahr 2025 fordert der Berichtsentwurf ehrgeizigere Maßnahmen, indem er empfiehlt, dass Reedereien über 33,3 % der geprüften Emissionen im Jahr 2023, 66,6 % im Jahr 2024 und 100 % im Jahr 2025 und in jedem darauf folgenden Jahr berichten. Durch die Vorverlegung des Datums für die vollständige Anwendung um ein Jahr, von 2026 auf 2025, werden offenbar etwa 57 Mio. Zertifikate für andere unter das EHS fallende Industriezweige verfügbar, die ansonsten nach dem Kommissionsvorschlag gelöscht worden wären.
Druck auf die IMO
100 % der Nicht-EU-Emissionen von Schiffen, die EU-Häfen anlaufen, sollen erfasst werden, wenn die IMO bis 2028 keine vergleichbare globale Maßnahme einführt: Da im ursprünglichen Entwurf des Vorschlags für das Emissionshandelssystem für den Seeverkehr nur 50 % der Fahrten außerhalb der EU erfasst sind, empfiehlt der Berichtsentwurf, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die internationale Zusammenarbeit fördern sollten, um schließlich 100 % der Fahrten außerhalb der EU zu erfassen. Im Berichtsentwurf wird gefordert, dass 100 % der Emissionen von Schiffen mit mehr als 5.000 GT, die zwischen EU- und Drittlandshäfen verkehren, in das ETS einbezogen werden. Der Berichtsentwurf stellt fest, dass die Erfassung aller Nicht-EU-Emissionen nur dann notwendig wird, wenn die IMO bis zum Ablauf der Frist für die globale Bestandsaufnahme des EU-Emissionshandelssystems im Jahr 2028, spätestens jedoch bis zum 30. September 2028, keine globale Maßnahme verabschiedet.
Zeitcharterer werden in die Verantwortung genommen
Zeitcharterer werden nun ausdrücklich in die Definition des Begriffs »Schifffahrtsunternehmen« aufgenommen. Die Verantwortung für das ETS und die Zahlung des Endpreises obliegt dem kommerziellen Betreiber, bei dem es sich nicht immer um das Schifffahrtsunternehmen handeln muss. In dem Berichtsentwurf wird empfohlen, eine verbindliche Klausel in die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien aufzunehmen, die sicherstellt, dass die Verantwortung für das ETS und die Zahlung der ETS-Kosten bei dem Unternehmen liegt, das letztendlich für die Entscheidungen verantwortlich ist, die sich auf die CO2-Emissionen des Schiffes auswirken (einschließlich der Wahl des Treibstoffs, der Route, der Geschwindigkeit und der Wahl der Ladung), und das für die Übernahme der Kosten für die Einhaltung der Vorschriften durch das Schifffahrtsunternehmen verantwortlich gemacht wird.
»Es ist noch nicht klar, ob eine solche verbindliche Klausel eine ausdrückliche rechtliche Anforderung oder eine stillschweigende Bedingung sein wird. Mit dieser Änderung soll anerkannt werden, dass das Schifffahrtsunternehmen nicht immer für den Kauf des Treibstoffs oder für betriebliche Entscheidungen, die sich auf die CO2-Emissionen des Schiffes auswirken, verantwortlich ist«, so die WFW-Experten. Diese Verantwortung könne im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung von einer anderen Stelle als der Reederei übernommen werden.
»Auf diese Weise würde das Verursacherprinzip in vollem Umfang gewahrt, und es ist zu hoffen, dass die Einführung von Effizienzmaßnahmen und saubereren Kraftstoffen weiter gefördert wird. Ein weiterer Grund für diese Änderung ist die Tatsache, dass die zuständigen Behörden häufig vor der Herausforderung stehen, einen kommerziellen Betreiber für Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU ausfindig zu machen, da es kein internationales Register für kommerzielle Betreiber in der Schifffahrt gibt. Auf diese Weise stellt der vorgeschlagene Ansatz sicher, dass die endgültige Verantwortung beim kommerziellen Betreiber liegt, indem eine vertragliche Verpflichtung zwischen dem Schiffseigner und dem kommerziellen Betreiber zur Abwälzung der Kosten festgelegt wird«, so Walker und Keys.
Weiter gefasster Blick auf Treibhausgase
Der Umfang der Treibhausgase, die von den Schifffahrtsunternehmen berücksichtigt werden müssen, könnte ab 2026 erweitert werden, um eine Angleichung an die Ziele des Pariser Abkommens zu gewährleisten. In dem Berichtsentwurf wird die Kommission außerdem aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2026 die Auswirkungen der Treibhausgasemissionen (außer CO2 und CH4) von Schiffen, die in Häfen unter der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats ankommen, sich dort aufhalten oder von dort abfahren, auf das globale Klima zu bewerten und dem EU-Parlament darüber Bericht zu erstatten.
F&E-Fonds wird empfohlen
Die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung in den Bereichen Dekarbonisierung des Seeverkehrs, sauberere Kraftstoffe, Kurzstreckenseeverkehr und sauberere Häfen wird empfohlen. In dem Berichtsentwurf wird empfohlen, dass dieser Fonds aus den Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten für Seeverkehrstätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems und aus Sanktionen, die durch die vorgeschlagene FuelEU Maritime-Verordnung zur Verbesserung der Energieeffizienz von Schiffen und zur Unterstützung von Investitionen zur Erleichterung der Dekarbonisierung des Seeverkehrs, auch im Hinblick auf den Kurzstreckenseeverkehr und die Häfen, erhoben werden sollte. Außerdem wird vorgeschlagen, dass der Meeresfonds besondere Unterstützung für Schiffe mit Eisklasse bereitstellen sollte, die als besonders schwer zu dekarbonisieren gelten.
Abstimmung über Änderungen im Juni 2022
Der Berichtsentwurf ist der erste Schritt in einem langen Prozess, bevor das Europäische Parlament seinen Standpunkt für die Verhandlungen mit dem Rat festlegt. Der Berichtsentwurf soll am 10. Februar 2022 geprüft werden und weitere Änderungsanträge sollen am 16. Februar 2022 eingereicht werden. Eine Abstimmung über die endgültigen Änderungen wird voraussichtlich im Juni 2022 stattfinden.
»Nach Angaben der European Community Shipowners Association (ECSA) enthält der Text nicht alle Punkte, die von der Industrie und den Interessengruppen seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Entwurfs am 14. Juli 2021 vorgebracht wurden, und es bleibt abzuwarten, was in den endgültigen Text aufgenommen wird. Klar scheint jedoch zu sein, dass das Emissionshandelssystem für den Seeverkehr trotz Widerstand von Teilen der maritimen Industrie hier ist, um zu bleiben«, so die WFW-Experten.