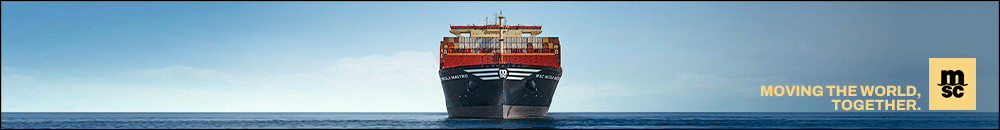Der niederländische Schifffahrtsdienstleister VPS hat in einer neuen, auf Kraftstofftests basierenden Analyse den Bunkermarkt und die damit verbundenen Herausforderungen in den Blick genommen. Ein Ergebnis: es wird auch 2025 weiter um Verfügbarkeit und vor allem Qualität gehen.
Das aus einem Laborunternehmen der Klassifikation DNV hervorgegangene Unternehmen konstatiert für 2024 eine steigende Nachfrage nach kohlenstoffärmeren Kraftstoffen, erweiterten Kraftstofftests und digitalen Lösungen zur Kraftstoffverwaltung.[ds_preview]
Trotz Fortschritten gab es demnach erhebliche Qualitätsprobleme bei VLSFO (hoher Schwefelgehalt, Kaltfließeigenschaften, Wassergehalt und Katalysatorrückstände) sowie bei MGO (Stockpunkt, Flammpunkt und FAME-Verunreinigungen). Der Einsatz von Biokraftstoffen nahm weiter zu, was zusätzliche Beratungen und Tests erforderlich machte.
Die Einführung der neuen ISO 8217:2024-Norm wurde in der Branche begrüßt. Die Spezifikationen wurden erweitert, um eine neue <0,50% Schwefel-Kategorie sowie Biokraftstoffe wie FAME, HVO und GTL einzubeziehen. Gleichzeitig verzeichnete die Schifffahrt eine Rekordzahl an Neubestellungen – 2.765 Schiffe mit insgesamt 124,2 Mio. GT, darunter 820 Schiffe mit alternativen Kraftstoffsystemen. Dies zeigt den klaren Wandel in Richtung nachhaltiger Schifffahrt.
Kraftstoffqualität und Bunker Alerts
VPS testete 2024 rund 65 Millionen Tonnen Schiffskraftstoffe. VLSFO (52 %) war am häufigsten vertreten, gefolgt von HSFO (32 %) und MGO (14 %). Die getestete Menge an Biokraftstoffen stieg auf 800.000 t, was ihren wachsenden Stellenwert für die Dekarbonisierung unterstreicht.
Zur Verbesserung der Kraftstoffsicherheit gab VPS 27 Bunker Alerts heraus, um kurzfristige Qualitätsprobleme in wichtigen Häfen zu identifizieren. Häufigste Mängel waren zu hohe Natriumwerte (33 %) und niedrige Flammpunkte (30 %). Besonders betroffen waren die Häfen Singapur und die ARA-Region.
VLSFO zeigte weiterhin hohe Abweichungen von den Spezifikationen (5,4 %), mit Europa als Spitzenreiter (11,9 %). Ein häufiges Problem war ein hoher Wachsauftaupunkt, der Filterverstopfungen und Rohrleitungsprobleme verursachen kann. Bei HSFO-Proben wurden 10,4 % außerhalb der Norm registriert, wobei hohe Viskosität (54 %), Dichte (21 %) und Wassergehalt (13 %) die größten Probleme darstellten.
Biokraftstoffe und neue Herausforderungen
Die Nutzung von Biokraftstoffen stieg 2024 deutlich an. B30 (mit 11-30 % Bioanteil) war die am häufigsten getestete Mischung. Die meisten Proben enthielten FAME, HVO oder HEFA. Gleichzeitig identifizierte VPS zunehmende chemische Verunreinigungen in Schiffskraftstoffen, darunter Cashew-Nussschalenöl (CNSL), das bei mehreren Schiffen zu schweren Motorschäden führte.
Mit der Einführung der ISO 8217:2024 wurden erstmals Biokraftstoffe standardisiert und neue Spezifikationen für VLSFO eingeführt. Dennoch werden zusätzliche Kraftstofftests notwendig bleiben, um Schiffsmotoren vor Schäden zu schützen.
Methanol als alternativer Kraftstoff
Methanol gewinnt als emissionsarmer Treibstoff an Bedeutung. 2024 boten weltweit 13 Häfen Methanol als Bunkerkraftstoff an. Während die meisten derzeit verfügbaren Mengen aus fossilen Quellen stammen, setzt die Branche verstärkt auf nachhaltige Varianten wie E-Methanol, Bio-Methanol oder blaues Methanol. Die Produktion dieser Kraftstoffe soll laut Prognosen bis 2050 erheblich steigen.
Methanol bietet Vorteile wie einfache Handhabung und geringere Umrüstkosten, doch die niedrige Energiedichte und begrenzte Verfügbarkeit von grünem Methanol bleiben Herausforderungen. In Singapur wurden 2024 neue Standards für Methanol als Schiffskraftstoff eingeführt, gefolgt von der Veröffentlichung des ISO 6583:2024-Standards zur Festlegung von Qualitätsanforderungen.
Fazit
2024 war ein entscheidendes Jahr für die maritime Kraftstoffindustrie. Biokraftstoffe, Methanol und verbesserte Qualitätsstandards spielten eine zentrale Rolle, um Umweltauflagen zu erfüllen und Emissionen zu senken. Dennoch bleiben Herausforderungen wie Qualitätsprobleme, chemische Verunreinigungen und technische Anpassungen bestehen. Mit steigender Nachfrage und schärferen Vorschriften wird die Branche auch 2025 verstärkt auf alternative Kraftstoffe und erweiterte Qualitätsprüfungen setzen müssen. (rup)