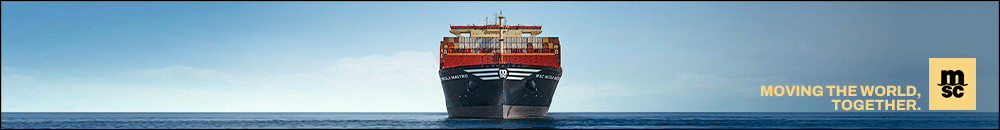Bei 407 Einsätzen wurden im vergangenen Jahr 43 Verschmutzungen in den deutschen Territorialgewässern sowie in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der Nord- und Ostsee identifiziert. Es wird eine positive Bilanz gezogen.
Das Havariekommando meldet jetzt Verunreinigungen durch Öl und andere Schadstoffe in Nord- und Ostsee „auf einem niedrigen Niveau“.[ds_preview]
Im Jahr 2024 entdeckten die Ölüberwachungsflugzeuge vom Typ Do 228 des Havariekommandos durchschnittlich alle 11 Flugstunden eine Verschmutzung in den deutschen Gewässern.
Bei 407 Einsätzen wurden 43 Verschmutzungen in den deutschen Territorialgewässern sowie in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der Nord- und Ostsee identifiziert – davon 33 in der Nordsee und 10 in der Ostsee. Zudem wurden den Angaben zufolge 58 weitere Verunreinigungen außerhalb deutscher Gewässer gefunden und an die zuständigen Behörden weitergegeben. Diese befanden sich in Seegebieten der Niederlande, Dänemarks, Großbritanniens, Polens und Schwedens. Das Beweismaterial zu möglichen Verursachern in deutschen Gewässern übergibt das Havariekommando der jeweils zuständigen Ermittlungsbehörde.

Die Anzahl der Verschmutzungen wird in Relation zu den Einsätzen und Flugstunden gesetzt. Für 2024 bedeutet dies, dass die Sensorflugzeuge etwa alle 11 Flugstunden eine Verunreinigung aufspürten. Zum Vergleich: In den Anfangsjahren der Ölüberwachung wurden im Durchschnitt noch alle 4 Stunden eine Verschmutzung entdeckt.
„Die in den deutschen Gewässern entdeckten Verunreinigungen waren geringfügig (weniger als 0,1 Kubikmeter), weshalb keine Maßnahmen zur Ölbekämpfung, wie der Einsatz von Ölauffangeinrichtungen oder technischem Gerät, ergriffen wurden“, heißt es weiter. Beide Ölüberwachungsflugzeuge wurden in den vergangenen Jahren modernisiert. Die neuen, noch leistungsfähigeren Sensorausrüstungen entdecken auch sehr kleine Verschmutzungen.
Havariekommando zieht positive Bilanz
Der Leiter des Havariekommandos, Robby Renner, zieht eine positive Bilanz der Ölüberwachung: „Ein weiteres Jahr arbeitete das Havariekommando gemeinsam mit den Marinefliegern daran, die Nord- und Ostsee zu schützen. Die hohe Anzahl an nationalen Überwachungsflügen ist ein starkes Signal an die Schifffahrt: Wer illegal handelt, bleibt nicht unbemerkt. Es ist entscheidend, dass wir unsere Anstrengungen fortsetzen, um die Meeresverschmutzung weiterhin auf diesem niedrigen Niveau zu halten“, so Renner weiter.

Die luftgestützte Überwachung von Meeresverschmutzungen ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Havariekommando und dem Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“. Die Piloten und Operator der Marine fliegen die beiden Do 228 im zivilen Auftrag für das Havariekommando. Ziel der Ölaufklärung ist es, Nord- und Ostsee kontinuierlich zu überwachen und Verschmutzungen in deutschen Gewässern zu finden. Dafür verfügen beide Sensorflugzeuge vom Typ Do 228 über hochsensible technische Ausstattung: Die Flugzeuge sind mit einem Radar, Infrarot- und Ultraviolettsensoren ausgestattet, die Ölfilme und andere Verschmutzungen auf der Wasserober-fläche erfassen können. Bei Unfällen auf See können die Flugzeuge damit außerdem wertvolle Informationen für das Havariekommando liefern.